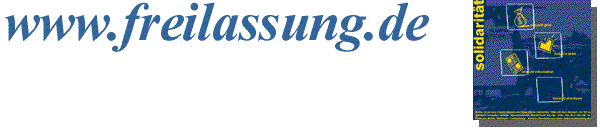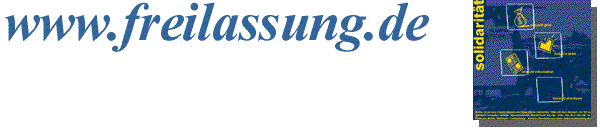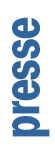 |
|
Datum:
April 2004
|
Zeitung:
So oder So! Nr.13
|
Titel:
Staatliche Geschichtsschreibung
|
Staatliche Geschichtsschreibung
Urteile im RZ-Prozeß
Nach bald drei Jahren mit insgesamt 174 Verhandlungstagen
ging am 17. März der Berliner RZ-Prozess zu Ende. Journalistische
wie alternative Prozessbeobachter zeigten sich „vom schnellen
Ende“ überrascht, obwohl die Bundesanwaltschaft und
die Verteidigung längst plädiert, und auch die Angeklagten
ihre Schlussworte gehalten hatten. Der 1. Strafsenat des Kammergerichts
Berlin unter Vorsitz von Richterin Gisela Hennig verurteilte
die fünf Angeklagten Sabine Eckle (57), ihren Ehemann Rudolf
Schindler (61), den früheren Leiter des Akademischen Auslandsamtes
der TU Berlin, Matthias Borgmann (55), den Mitarbeiter der „Forschungsgesellschaft
Flucht und Migration“, Harald Glöde (55), sowie den
Hausmeister des Berliner Mehringhof, Axel Haug (53), zu mehrjährigen
Haftstrafen. Mit dem Urteil wurden die Haftbefehle aufgehoben.
Durch Anrechnung der zum Teil 28-monatigen U-Haft dürften
bis auf Borgmann alle Verurteilten auf freiem Fuß bleiben.
Ein Teil der Angeklagten legte Revision gegen das Urteil ein.
Sabine Eckle und Rudolf Schindler wurden zu drei Jahren und
neun Monaten wegen „Rädelsführerschaft“
und Beteiligung an den Sprengstoffanschlägen auf die
Zentrale Sozialhilfestelle für Asylbewerber (ZSA) verurteilt.
Die härteste Strafe mit vier Jahren und drei Monaten
erhielt Mathias Borgmann, dem auch der Sprengstoffanschlag
auf die Berliner Siegessäule 1991 zugeordnet wurde. Strafverschärfend
wirkte sich aus, dass er, anders als drei Mitangeklagte, keine
Einlassungen machte. Zu 31 Monaten wurde Harald Glöde,
und Axel Haug zu 32 Monaten verurteilt. Das Gericht sah es
als erwiesen an, dass alle Angeklagten an den Knieschüssen
auf den damaligen Leiter der Berliner Ausländerbehörde,
Harald Hollenberg, und den Vorsitzenden Richter des Bundesverwaltungsgerichts,
Günter Korbmacher in den Jahren 1986 und 1987 beteiligt
waren. Beide Attentate spielten aber wegen Verjährung
strafrechtlich keine Rolle mehr.
Wie schon die Anklage beruht auch das Urteil im wesentlichen
auf den Aussagen des Kronzeugen Tarek Mousli. Obwohl die Verteidigung
wie auch die Angeklagten selbst den ganzen Prozess über
versuchten, den Kronzeugen zu demontieren und unglaubwürdig
zu machen, hielten die Richter unerschüttert an ihm fest.
Tarek Mousli war dem Staatsschutz ins Netz gegangen und hatte
dann in umfangreichen Aussagen die fünf Angeklagten ans
Messer geliefert. Zum großen Teil beruhte sein Wissen
auf Hörensagen, Angaben zu Sprengstoffdepots konnten
z.B. nie durch entsprechende Funde bestätigt werden.
Die Einlassungen von Eckle, Schindler und Haug, in dem sie
ihre Mitgliedschaft in den Revolutionären Zellen zugaben,
gleichzeitig aber den Angaben von Tarek Mousli teilweise widersprachen,
erhöhte für das Kammergericht die grundsätzliche
Glaubwürdigkeit des Kronzeugen.
Bundeswalt fordert politischen Prozess
Wie zum Hohn forderte Bundesanwalt Bruns einen politisch
geführten Prozess und warf den Angeklagten vor, sich
wie eine Autoschieberbande zu verhalten. Tatsächlich
waren die Bundesanwälte die einzigen in diesem seit Mai
2001 andauernden Prozess, die sich an der Politik der Revolutionären
Zellen abarbeiteten. Ihr zentrales Interesse war denn auch
von Anfang an nicht zwangsläufig das Strafmass selbst,
sondern die justizielle Abrechnung mit den Revolutionären
Zellen. Die Geschichte der revolutionären Linken, so
die Message der Bundesanwaltschaft, wird von ihr geschrieben.
Ein Sieg über den bewaffneten Kampf muss auch dann errungen,
zur Not auch konstruiert werden, wenn die Aktivisten selbst
mit diesem Kampf schon lange nichts mehr zu tun haben, vielleicht
auch gar nicht mehr zu tun haben wollen. Dieser Prozess vermittelte
zweierlei. Von Seiten des Staatsschutzes sein unbedingtes
Verfolgungsinteresse, wozu auch 1 1/2 Jahrezehnte zurückliegende
Aktionen verurteilt werden müssen. Von Seiten der Angeklagten
und ihrer Verteidigung, dass man in so einem Verfahren keine
Chance hat, wenn man sie nicht nutzt. So sind die Angeklagten
in diesem Verfahren Objekt der Bundesanwaltschaft geblieben
und haben sich in eine vorgegebene Rolle gefügt. Die
Urteile machen deutlich, dass eine Prozesstaktik, die auf
Kooperation und Entpolitisierung setzt, auf keinen Fall belohnt
wird. Die Urteile wären auch kaum anders ausgefallen,
wenn die Verteidigung diesen Prozess als politischen Prozess
geführt hätte.
Politische Prozessführung ist davon gekennzeichnet,
dass die Angeklagten und ihre Verteidigung als Subjekte ihrer
Geschichte handeln, unabhängig davon, ob sie die Taten
begangen haben, deren sie angeklagt sind. Auf der Anklagebank
sitzen Personen, aber durch sie die Politik und Moral der
Linken, einer Strömung oder Organisation. Ziel der Staatsschutzjustiz
war in diesem, wie auch in allen anderen Verfahren gegen die
militante und bewaffnete Linke die Zerstörung der politisch-moralischen
Integrität. So funktionalisierte die Bundesanwaltschaft
die Angeklagten für den Sieg über die Revolutionären
Zellen. Offensichtlich herrschte dort aber mehr Sorge vor
der Funktionalisierung für eine Politik, die längst
vorbei ist. Wie gesagt, belohnt wird das nicht.
|